IRRMa – Verbundprojekt „Entwicklung und Anwendung eines interkommunalen Reststoff- und Recycling-Managementsystems (IRRMa)“









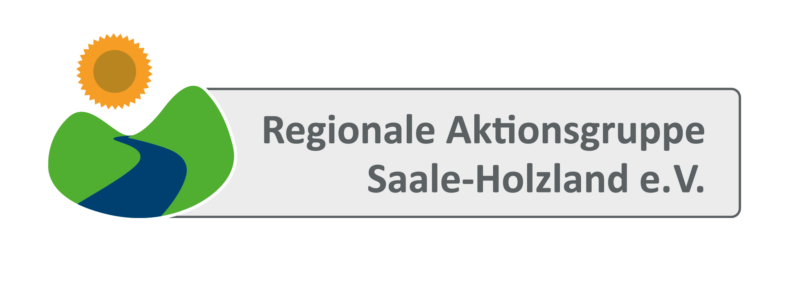
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung rief im Rahmen des Förderprogramms „REGION.innovativ“ zu Projektvorschlägen zum Thema „Interkommunale Zusammenarbeit zur Stärkung einer regionalen Kreislaufwirtschaft in strukturschwachen Regionen“ auf. Die Saale-Holzland-Region konnte sich mit zehn regionalen Partnern im zweistufigen Wettbewerb mit dem Konzept „IRRMa – Entwicklung und Anwendung eines interkommunales Reststoff- und Recycling-Managementsystem“ erfolgreich durchsetzen.
Hintergrund der Bewerbung war, dass die Mengen der in der Region anfallenden organischen Reststoffe (Grasmahd, Laub, Garten- und Küchenabfälle, Astschnitt etc.) immens sind, deren Eigenschaften vielfältig und die nachhaltige Verwertung bis hin zur Nutzung vielfach ungelöst.
Für eine umfassende, speziell auch ökonomische, Nutzung müssen die in den organischen Reststoffen vorhandenen Wertstoffe zu möglichst hochwertigen Produkten wie Dünger, Humuserden und nicht zuletzt Energie aufbereitet werden, die „konventionelle“ Erzeugnisse mit vergleichbarem Anforderungsprofil ersetzen können. Dies erfordert spezifischer Aufbereitungs- und Verwertungskonzepte sowie neuer Technologien, angepasst an die Gegebenheiten der Region. Dieser Herausforderung haben sich die Kooperationspartner aus unterschiedlichen Forschungseinrichtungen, kommunalen Gebietskörperschaften und Unternehmen der Abfallwirtschaft gestellt.
Die Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V. ist Lead-Partner des Verbundprojektes
Worum geht es in dem Verbundprojekt IRRMa?
- Inwertsetzung sämtlicher organischer Reststoffströme
in den Kommunen i.S.d. Kreislaufwirtschaft
- Interkommunale Zusammenarbeit intensivieren
- Digitale Schnittstelle zwischen Anfall und Verwertung – Bedarfs- und Qualitätsmeldung der einzelnen Verwertungswege -> Angepasste Logistik (Sammlung, Lagerung) und Verwertungswege
- fachliche Aus- und Weiterbildung & Wissenstransfer



Projektziele und Herausforderungen
Eine nachhaltige Verwertung organischer Reststoffe ist vielfach ein ungelöstes Problem. Für eine umfassende Nutzung müssen die vorhandenen Wertstoffe zu hochwertigen Produkten aufbereitet werden. Erschwerend sind dabei legislative, administrative, technisch-logistische und kommunikative Hindernisse.
Zentrales Element in IRRMa ist die Entwicklung und Umsetzung eines gemeinsamen, diversifizierten,
strukturell, rechtlich und ökonomisch belastbaren, zukunftsfähigen Entsorgungs- und Verwertungskonzepts, das eine weitreichende Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Die Potenziale der Digitalisierung und einer intensiven Kooperation der verschiedenen regionalen Akteure (Kommunen, deren Zweckverbände, Industriepartner, angewandter Forschung) müssen genutzt werden.
Im Projekt wurden bezüglich der regionalen Gegebenheiten ökonomische und ökologische Ansätze sowie Werkzeuge und Technologien für eine interkommunale und regionale Verwertung von organischen Reststoffen im Sinne der Kreislaufwirtschaft modellhaft erprobt werden. Für ausgewählte Stoffströme wurden der Anpassungsbedarf der vorhandenen Verwertungstechnologien, wie Biogas-, Kompostier- oder Verbrennungsanlagen, an die neuen Substrateigenschaften ermittelt, umgesetzt und bewertet.
Durch die erforderliche Einbindung unterschiedlicher Akteure in den Umsetzungsprozess soll die Akzeptanz für das Verwertungskonzept erreicht werden. Die fachliche Aus- und Weiterbildung zur Gewinnung von Fachkräften für die Umsetzung der Verwertungskonzeption komplettieren die Projektaufgaben. Diese Vorgehensweise und Verwertungskonzeption hat den Anspruch aus der Modellregion in andere Regionen übertragbar zu sein.
Aktuelle Situation und Chancen
- Reststoffe werden nicht der jeweils optimalen Verwertung zugeführt
- Durch unsachgemäße Sammlung sind die Endprodukte oft
mit (Mikro-)Plastik belastet, so dass eine Verbreitung in der Umwelt (Landwirtschaft) erfolgt
- Ein Upcycling (z.B. von Fasern) wird in der aktuellen Entsorgungsstrategie der Kommunen auf Grund fehlender Informationen zu den einzelnen Reststoffströmen nicht berücksichtigt
- Eine Bündelung von hochwertigen Reststoffströmen für eine optimale Verwertung im Sinne der Kreislaufwirtschaft erfolgt auf Grund fehlender interkommunaler Zusammenarbeit nicht.
Chancen für Kommunen & Landwirtschaft
- Nachfrage nach biobasierten Rohstoffen wächst (Ersatz für fossile Quellen)
- Regionale Wertschöpfung durch neue Produkte
- Energetische Nutzung durch Versorgung von Quartieren
- stoffliche Nutzung wie Dämmstoffe, Graspapier, Dünger, Kompost
- existiert ein Markt, kann man einen Preis zu Kostendeckung erzielen
- Bisherige Verwertung & Entsorgung geht hingegen voll
zu Lasten der kommunalen Haushalte.
- Sauber getrennte Erfassung ist Voraussetzung Mehrwert zu heben
Umsetzung
Im Ersten Schritt stand die Zusammenstellung des kommunalen Datenbestandes (Mengen, Zusammensetzung, Qualität, GIS, Zeit, Struktur Sammelgebiete) sowie die Bestandaufnahme bestehender Technologien zur Verwertung (z.B. BGA, Biomasseheizkraftwerk) in der Region im Fokus.
Schnell wurden die Datenlücken und fehlenden Datenbanken erkannt und wurden im nächsten Step mit Beprobungen und Analysen der beteiligten Forschungsinstitute aufgefüllt. Nach Datenharmonisierung fließen diese in eine Datenbank und sind Grundlage für weiteres praktisches Handeln und virtuelle GIS-Umgebung.
Die Entwicklung eine Softwaretools zur Abbildung der Verwertungsabläufe auf einer digitaler Plattform stell ein wesentliches Aufgabe und Ziel des Projektes dar.
Im Projekt soll ein softwarebasiertes, GIS-unterstütztes interkommunales Managementsystem gemeinsam mit den kommunalen Partnern, Vertretern der Entsorgungs- und Verwertungsbranche, Softwareentwicklern und Forschungseinrichtungen entwickelt und unter realen Bedingungen mit ausgewählten Technologiebausteinen getestet werden. Dies wird die Partner befähigen, den gesamten Ablauf und Verwertungsprozesses von organischen Reststoffen hin zu hochwertigen Produkten,
wie nährstoffhaltige Bodensubstrat, Naturfasern oder Nährstoffen, in einer neuen hoch effizienten Art und
Weise umzusetzen.
Konzeptionelle und experimentelle Entwicklung angepasster Verwertungstechnologien
- Entwicklung neuere Handling-, Aufbereitungs- und Lagerungskonzepte für die qualitätsorientierte Getrenntsammlung org. Reststoffe
- Labortechnische Ermittlung von Verfahrensanpassung infolge geänderter Stoffeigenschaften in der Kompostierung, Fermentation und Verbrennung
Überführung ausgewählter Technologieansätze in den technischen Maßstab zur Überprüfung der Machbarkeit und zur Erfassung technischer und wirtschaftlicher Parameter
- Erprobung der neuen Handling-, Aufbereitungs- und Lagerungskonzepte für getrenntgesammelte Qualitäten an org. Reststoffen (Bringsystem)
- Modellhafte Testung Verwertungsweg Biogaserzeugung, Verbennung und landwirtschaftliche Verwertung
- Modellhafte Testung Verwertungsweg Spezialerden
Konzeption und Erarbeitung von Schulungs- und Weiterbildungsangeboten (digitale Lernplattform)
Handreichung für eine kommunale Eigenverwertung von pflanzlichen Reststoffen über eine Kompostierung

Ausblick
Die beteiligten Kommunen prüfen eine verbindliche gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich der Verwertung organischer Reststoffe, zum Beispiel durch Gründung eines Zweckverbands.
• Stärkung und Aufbau einer regionalen Kreislaufwirtschaft
• Substituierung fossiler Rohstoffe / Inwertsetzung von Reststoffen
• Sichtbarmachung von Potentialen über kommunale Grenzen hinaus
• Vernetzung und bessere Information von Marktteilnehmern
• Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit
• Niedrigschwellige Teilnahme












